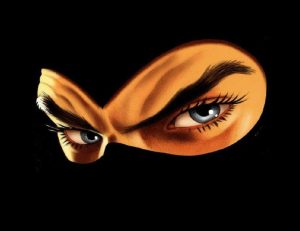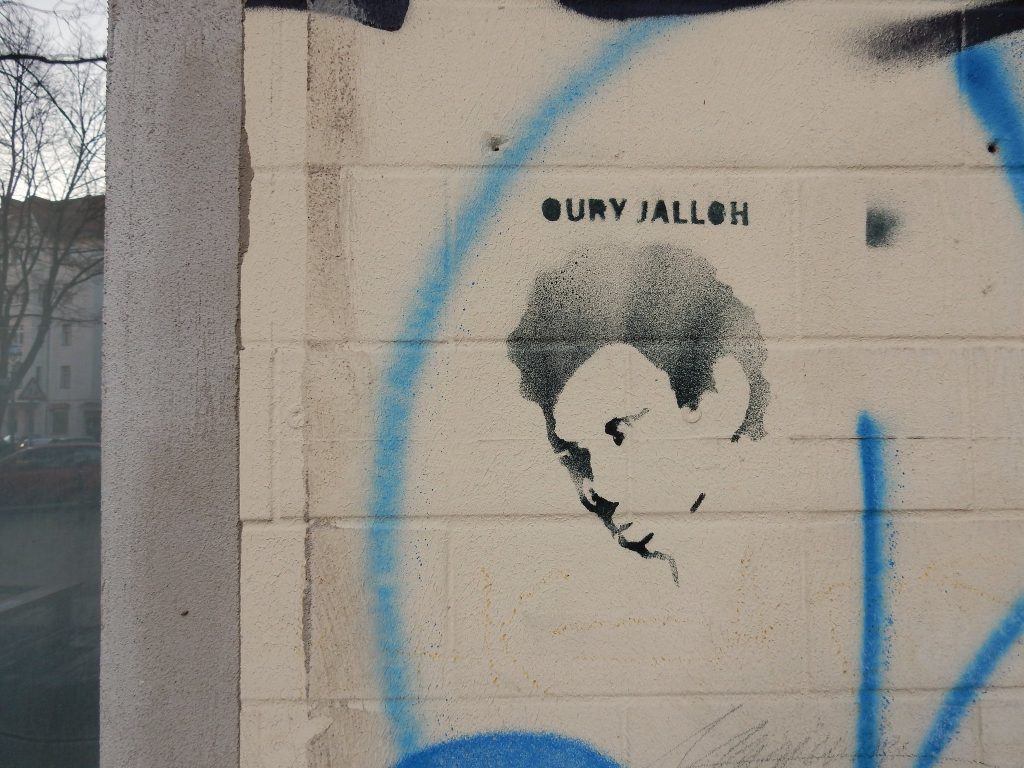„We will shine for these nine“ — So lautet das Motto des Bündnisses „München erinnern!“ zum diesjährigen Gedenken an das rechtsterroristische Attentat im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) vor genau acht Jahren, am 22. Juli 2016. Acht Jugendliche und eine Erwachsene, ihre Namen stehen im Zentrum des Erinnerns: Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabine, Selçuk und Sevda, verloren ihr Leben bei dem Anschlag im Juli 2016 im OEZ. Erst viele Jahre und etliche Gutachten später war es offiziell: Es war kein „Amoklauf“, wie die Medien die Tat all die Jahre framten, sondern ein rechtsterroristischer Anschlag. Seitdem kämpfen Angehörige darum gehört zu werden.
Apsilon zollt Respekt
Am Wochenende gedachten etliche Hundert Menschen der Ermordeten bereits bei einem Konzert, einem Podium und einer Lesung. Viele Beiträge auf den Bühnen betonten, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem sei. Der Berliner Rapper Apsilon zeigte sich berührt davon, zum Gedenken eingeladen worden zu sein, und erzählte auf der kleinen Musikbühne und in seinen Songtexten von Rassismus-Erfahrungen seit seiner Kindheit.
Dringlicher Tenor der Veranstaltung war es, dass sich eben auch und vor allem Nicht-Betroffene von Rassismus solidarisch verhalten sollten. Es sei auch ihre Aufgabe, auf die Gefahr rassistischer Ideologie und Gewalt hinzuweisen und die Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Am eigentlichen Gedenktag, dem Montag, 22. Juli, versammelten sich abends Angehörige der Opfer, viele Unterstützer*innen und Trauernde am Ort des Anschlags vor dem OEZ. Es waren Lieder zu hören, die die Getöteten gerne gehört haben oder solche, mit denen Freund*innen und die Familien an sie erinnerten.
Gedenken nach 8 Jahren am Tatort selbst, dem Olympia Einkaufszentrum (OEZ) in München, am 22.7.24/caption]
Schmerz des Vermissens
Oberbürgermeister Dieter Reiter verwies darauf, dass München die Stadt mit den meisten rechtsterroristischen Anschlägen in Nachkriegsdeutschland sei. Auch er betonte die Wichtigkeit, auf die Wünsche der Angehörigen einzugehen und sprach von München als „bunter und demokratischer Stadt“.
Nach dem Stadtoberhaupt sprachen die Angehörige der Getöteten: Dabei erzählten sie nicht nur von dem Leben ihrer verlorenen Kinder und Geschwister und der ermordeten Mutter und Ehefrau, sondern vom Gefühl des Vermissens. Eine der Angehörigen forderte zudem mehr Aufklärung über das Vorgehen der Polizei und Behörden zum Tatzeitpunkt. Sie äußerte deutliche Kritik am Umgang mit dem Anschlag und seiner Einstufung als Amoklauf durch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Eine weitere Angehörige äußerte ihre tiefe Sorge über die zunehmende Macht der völkisch-nationalistischen Partei AfD.
Zum Zeitpunkt des Attentats versammelten sich Freund*innen und Familien an dem für die Verstorbenen errichteten Denkmal und ließen Luftballons aufsteigen. In einer Schweigeminute gedachten alle Anwesenden der getöteten Menschen.
Der Täter mag alleine geschossen haben – dennoch steht der Anschlag in München nicht vereinzelt im Raum, sondern ist nur ein Beispiel für rassistische Morde in Deutschland. Das Attentat in Hanau, der antisemitische Anschlag auf die Synagoge in Halle, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walther Lübcke, aber auch der jüngste Brandanschlag auf eine Familie in Solingen, zahlreiche brennende Unterkünfte für Geflüchtete oder der von der Polizei getötete Mouhamed Lamine Dramé sind nur einige Beispiele, bei denen Menschen aufgrund einer rassistisch-nationalistischen Ideologie der Täter ihr Leben verloren.
Netzwerk der Betroffenen
Diese schrecklichen Taten zu verknüpfen und zusammen zu sehen, ist für die Angehörigen wichtig. Die Verwandten und Freund*innen der Opfer rassistischer Morde in verschiedenen Städten Deutschlands sind inzwischen gut vernetzt und besuchen sich gegenseitig bei Gedenkveranstaltungen, war während der Gedenkveranstaltung zu hören. Die Angehörigen aus München versicherten, dass ihnen das Gefühl, mit ihrer Trauer und Wut nicht alleine zu sein, Kraft gebe.
Tell their stories
Unter den Anwesenden wurde das Heftchen „Tell their Stories“ verteilt. In dem berührenden Booklet veröffentlichen Angehörige etlicher der Ermordeten Bilder, Gedichte, Erinnerungen und Geschichten aus dem Leben der Opfer. Die Botschaft auch hier: Nicht nur die Namen der Getöteten dürfen niemals in Vergessenheit geraten – auch ihre Geschichten müssen gehört werden!