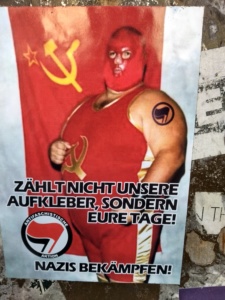Maximilian Fuhrmann / Sarah Schulz: Strammstehen vor der Demokratie. Extremismuskonzept und Staatsschutz in der Bundesrepublik. Stuttgart 2021.

»Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – interpretieren sie aber auf ihre Weise um.« Dieser Satz war zehn Jahre lang in einem Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) über sogenannten Linksextremismus zu lesen und stand in diesem Zeitraum unbeachtet im Web. Ein Tweet im Januar 2021 löste einen Shitstorm von Konservativen und extrem Rechten aus. Die Ideen des Liberalismus könnten nicht in einen Bezug zu „linksextremen“ Bewegungen gesetzt werden, so der Tenor. Daraufhin intervenierte das Bundesministerium des Innern, dem die bpb untergeordnet ist, und verlangte eine Änderung des Textes zugunsten einer Formulierung des Verfassungsschutzes. Weiterlesen „Rezi: Strammstehen vor der Demokratie.“