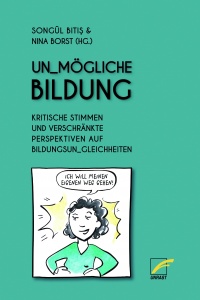Ein Interview mit Nina und Songül
Nina und Songül, ihr habt 2012 die Ausstellung «Lux like Comic – (Un)Mögliche Bildungswege» erstellt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Unser Bildungsauftrag im Rahmen der Stiftung war ein Konzept zu entwickeln, dass die Bildungssituation von Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben, thematisiert und in die Öffentlichkeit bringt. In einem kleinen Rahmen konnten wir Studienstipendien für diese Zielgruppe vergeben und somit Einzelpersonen über eine Finanzierung und Begleitung den Zugang zu Hochschulen ermöglichen. Unsere Projektzielgruppe waren Menschen ohne akademischen Bildungshintergrund, das bedeutet Menschen, deren Elter_n nicht studiert haben und die sich im Übergang von Schule/Praktikum ins Berufsleben/Studium befinden.
Die finanziellen Rahmenbedingungen waren in diesem Projekt ziemlich gut. Da konnten wir unsere Ideen und Kreativität gut entfalten. Was uns etwas Druck bereitet hat, war, dass wir nur eine sehr begrenzte Zeit hatten, dieses Projekt umzusetzen. Und wir wollten das Projekt ja über einen linken Kreis von Interessierten hinaus in die Öffentlichkeit bringen – und zwar mit Berücksichtigung von strukturellen Machtverhältnissen, die bei Diskursen rund um PISA meistens aus dem Blick geraten. Daher wollten wir das Thema so angehen, dass es alle angeht und alle interessiert. Dazu bedurfte es auch, dass wir das Thema aus den akademischen Kontexten rausholen und barrierefreier gestalten. Weiterlesen „Gemeinsam könnten wir das Haus rocken!“