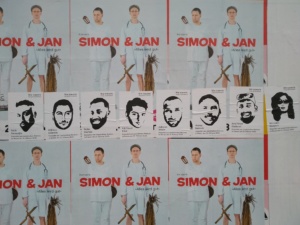
Am Rande einer der ersten Kundgebungen nach dem Massaker von Hanau, dem acht Besucher und eine Angestellte in zwei Shisha-Bars sowie die Mutter des Attentäters zum Opfer gefallen waren, stellte sich der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, nach den üblichen Betroffenheitsübungen auf der Bühne, live den Fragen des Reporters Markus Gürne für den ARD-Brennpunkt am 20. Februar. Gürne stellte die durchaus naheliegende Frage: „Warum hat Hessen eigentlich so ein besonderes Problem?“ Dass Bouffier sagen würde: „Ich glaube nicht, dass wir ein besonders Problem haben“, war klar.
Hanau ja, aber…
Dass er angesichts der bizarren Häufung rechter Attentate und Vorfälle in Hessen — insbesonder bei der Polizei — leugnen würde, dass was faul sein könnte in seinem Staat, ist da nur konsequent: “Wir haben ganz herausragende, furchtbare Taten, wenn ich an letztes Jahr an den Tod von Dr. Walter Lübcke denke oder den heutigen Tag, das ist einfach furchtbar.“ — jetzt kommt’s — „ABER, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass wir Anzeichen haben, dass wir in ganz besonderer Weise eine strukturelle Problematik haben, die uns von anderen unterscheidet.“ Die Bodenlosigkeit dieses „Hanau ja, aber…“ ging im ruhigen Fluss der ledrigen Beredsamkeit des Landesvaters ebenso unter wie eine kritische Nachfrage Gürnes angesichts von Bouffiers Mitverantwortung an jener „besonderen Problematik“ in Hessen unterblieb.
Bouffier Teil des Problems
Wir erinnern uns, es war der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier, der massiv in die Ermittlungen gegen den seinerzeit des Mordes an dem Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat am 6. April 2006 verdächtigen Geheimdienstmitarbeiter und V‑Mann-Führer Andreas Temme eingriff. Bouffiers Ministerium unterband die polizeilichen Vernehmungen der von ihm geführten Informanten aus der Naziszene und nahm darüber hinaus Einfluss darauf, dass das Ermittlungsverfahren gegen Temme rasch eingestellt wurde (-> konkret xy). Es sind nicht nur in diesem Fall hessische Behörden, die für die Nicht-Aufklärung sorgen, Bouffier ist mithin Teil des Problems. Vorwissen, Verstrickung und Mitverantwortung des hessischen Verfassungsschutzes werden bis heute auf höchster Ebene gedeckt und das, obwohl der Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke — wieder in Kassel — immer neue „strukturelle Probleme“ der hessischen Behörden offenbart. Inzwischen dürften sich die Verbindungslinien vom NSU in die Kasseler sowie — im Zusammenhang mit dem Mord an dem Dortmunder Kioskbetreiber Mehmet Kubaşık zwei Tage vor dem Mord an Halit Yozgat — in die Dortmunder Nazi-Szenen herumgesprochen haben. Trotzdem mauern die hessischen Behörden, sperren die dazu gehörigen Akten und produzieren so immer neue, zum Teil erst per Gerichtsbeschluss preisgegebene Hinweise, die eine tiefe Verstrickung der Behörden in das rechte Terrorgeschehen nahelegen.
Temme passt ins Bild
Es ist ein antifaschistischer Rechercheverbund, Exif, der immer wieder die entscheidenden Informationen präsentiert und ein ums andere Mal nicht nur die hessischen Behörden düpiert. Die nicht verfolgten Spuren im „hessischen Ausschnitt“ des NSU-Komplexes deuten auf enge Kontakte zwischen der ursprünglichen NSU-Kerntruppe und Akteur*innen in Kassel und Dortmund hin. Eine dieser Spuren etwa heißt Corryna G[oertz] und wurde einzig auf Betreiben der Linksfraktion im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss dort als Zeugin gehört. Sie ist nicht nur Verbindungsglied zwischen Thüringen, Kassel und Dortmund, sie gab zur Überraschung der Ausschussmitglieder auch an, das Internetcafé Yozgats in Kassel gekannt zu haben. Möglicherweise stammt sogar eine Skizze der Räumlichkeiten dort von ihr. In einem Schaubild von Exif zum mörderischen Nazi-Netzwerk in Kassel passen neben G[oertz] auch der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stephan Ernst, sein Komplize Markus Hartmann, der Chef des kürzlich verbotenen rechten Terror-Zirkels „Combat 18“, Stanley Röske, der VS-Informant unter Temmes Führung, Benjamin Gärtner, ein bisher überhaupt noch nie vernommener Neonazi und Nachbar von Yozgats Internetcafés, M.K., und eben Temme selbst ins Bild: Bis heute sind aufgrund der Behördenobstruktion die zwei genannten NSU-Morde nicht annähernd aufgeklärt. Anderenfalls hätte der dritte Mord an Walter Lübcke und zahllose weitere schwere Straftaten, die Personen auf dem Schaubild zugeordnet werden, möglicherweise verhindert werden können. Und immer neue Hinweise lassen aufhorchen: Im Jahr 2003 entging ein antifaschistisch engagierter Lehrer in Kassel nur knapp einem Mordanschlag. An einem frühen Morgen im Februar schossen Unbekannte mit einer großkalibrigen Waffe durch sein erleuchtetes Küchenfenster auf ihn: Zum Glück verfehlten sie ihn. Er habe, so stand es damals in der Zeitung, „den Lufthauch gespürt“.
„NSU 2.0“
Seither und insbesondere nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess am 11. Juli 2018 werden immer wieder Polizeiskandale aus Hessen, aber auch aus anderen Bundesländern, bekannt: Schon einen Monat nach dem Münchener Urteil begann eine Serie von Drohbriefen gegen die Nebenklage-Anwältin im NSU-Prozess Seda Başay-Yıldız in Frankfurt. Es stellte sich bald heraus, dass ihre an sich geschützten privaten Daten über einen Polizeicomputer in Frankfurt abgefragt worden waren. Es gab Hausdurchsuchungen bei fünf Polizeibeamt*innen, denen eine Beteiligung an den Drohbriefen vorgeworfen wird. Die Drohungen waren mit „NSU 2.0“ unterzeichnet. Weitere Beamte der hessischen Polizei wurden in der Folge wegen Weitergabe oder Missbrauch von Daten politischer Gegner*innen vom Dienst suspendiert. Schon fast gewöhnt hat man sich seither an eine beispiellose Drohbrief-Kampagne und Serie von Bombendrohungen gegen hunderte kommunale Behörden, Institutionen, antifaschistische Initiativen und Einzelpersonen. Sie kommen von bis heute weitgehend unbekannten Absendern, die sich wahlweise „NSU 2.0“, „Staatsstreichorchester“, „Nationalsozialistische Offensive“, „Atomwaffendivision“ oder „Wehrmacht“ nennen — und sie dauern an.
Unterdessen häufen sich solche Vorfälle polizeilicher Kumpanei mit Nazis und anderen Rechten im ganzen Land. Insofern mag Bouffier ja zumindest in dem Punkt recht haben, dass es woanders auch irgendwie nicht besser sei…
Dies ist Teil I eines zweiteiligen Artikels, dessen fehlender Teil in zwei Wochen hier erscheinen wird und jetzt schon in konkret 4/2020 zu lesen ist.