«Gastarbeiterinnen» in Kärnten resultiert aus einem Forschungsprojekt an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, das die Spuren der weiblichen Arbeitsmigration untersucht. Es ist in drei Teile gegliedert: Nach der Einleitung wird der theoretische Rahmen der Arbeit zu Migration, Erinnerung und Geschlecht dargestellt, dann werden Tageszeitungen der 1960er und 1970er Jahre untersucht und zum Schluss Auszüge aus biografischen Interviews dokumentiert und reflektiert.
Author: Bernd Hüttner
F wie Antifa
Rezension: Herausgeber_innenkollektiv: »Fantifa. Feministische Perspektiven antifaschistischer Politiken«, Verlag edition assemblage, Münster 2013, 194 Seiten, 12,80 Euro [gefördert von der Rosa Luxemburg Stiftung]
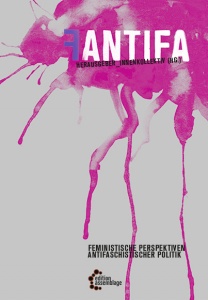 Faschismus wird meist als zutiefst männliches Phänomen wahrgenommen, und auch der Antifaschismus wird häufig als männlich dominiert angesehen. Dies kritisierten linksradikale Frauen Ende der 1980er Jahre und gründeten feministische Antifa-Gruppen, die insbesondere in den frühen 1990er Jahren aktiv waren. Die meisten lösten sich dann aber bald wieder auf.
Faschismus wird meist als zutiefst männliches Phänomen wahrgenommen, und auch der Antifaschismus wird häufig als männlich dominiert angesehen. Dies kritisierten linksradikale Frauen Ende der 1980er Jahre und gründeten feministische Antifa-Gruppen, die insbesondere in den frühen 1990er Jahren aktiv waren. Die meisten lösten sich dann aber bald wieder auf.
In diesen Gruppen wurde vor allem über die Rolle von Männern und Frauen in der Nazi- und der Antifa-Szene diskutiert. Erstens gab es unter den Nazis schon immer viele Frauen, womit Frauen nicht nur Opfer waren, als welche sie im Zusammenhang mit Nazi-Aktivitäten häufig genannt werden. Diese Diskussion wird in der Frauenforschung unter dem Begriff der (Mit-)Täterschaft von Frauen an patriarchalen oder auch faschistischen Verhältnissen geführt. Zum anderen kritisierten die Frauen das dominante Verhalten antifaschistischer Männer, die sowohl in Analyse als auch Praxis Menschen ausschließen und sich mit ihrem gewaltbereiten Auftreten ihren Feinden und der Polizei letztlich recht ähnlich seien.
Das Phänomen der »Fantifa« betrachtet nun ein neues Buch, das im Verlag edition assemblage erschienen ist. Herausgegeben wurde es von zwei Frauen und zwei Männern, die sich in der autonomen, antirassistischen und antifaschistischen Linken bewegen. Im ersten Block lassen sie Aktivistinnen aus fünf mittlerweile nicht mehr existierenden Fantifa-Gruppen in längeren Interviews zu Wort kommen. Im zweiten Block werden die theoretischen Debatten nochmals vertieft.
Das Buch macht deutlich: Antisexistisches antifaschistisches Handeln ist kein »Frauenthema«. Linke Männer tragen die hegemonialen Männlichkeiten mit und halten diese aufrecht — dazu finden sich zwei spannende Interviews im dritten Teil. Danach werden vier bekanntere, derzeit aktive, antisexistische Antifa-Gruppen aus Leipzig, Wien, Marburg und Bremen interviewt und damit die Entwicklung der letzten zehn Jahre nachvollzogen. Das Buch holt eine nahezu vergessene Debatte nochmals ins Bewusstsein. Eine Debatte, die bis heute nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt hat. Mit »Fantifa« liegt ein lesenswertes Geschichtsbuch zu einem heute eher vergessenen Strang der radikalen Linken vor. Die im Faksimile abgedruckten Texte, die über ein Viertel des Buches einnehmen, werden ältere Lesende eher nostalgisch an ihre Jugend erinnern.
Diese Rezension erschien am 14.8. auch im „Neuen Deutschland“.
Eine weitere Rezension aus analyse & kritik ist auf der RLS-Homepage hier zu finden.